Martin Hennicke startete mit einem Rückblick auf die EU-Strukturfonds. Er kam u.a. zu der Einschätzung, dass das Kernziel der Kohäsion bis heute nicht erreicht wurde. Disparitäten sowohl zwischen den EU-Mitgliedsstaaten als auch in NRW, insbesondere im Ruhrgebiet, sind kaum messbar abgebaut worden. Seit jeher werden die Mittel durch die Länder verwaltet, die sie als eine Art „Ersatzhaushalt“ ansehen mit einem viel zu breiten wenig zielführendem Mitteleinsatz. Positiv zu werten sei jedoch der EU-Anspruch gegenüber den Mitgliedstaaten, ihre Förderstrategien aus Analysen abzuleiten. Das habe es in Deutschland vorher so nicht gegeben.
Vor diesen Hintergründen hatte eine GFS-Arbeitsgruppe letztes Jahr ein Positionspapier erstellt. Dessen Kernforderung der thematischen Konzentration der Gelder erscheint vor dem Hintergrund multipler Ressorts auf EU-Ebene genauso wie in NRW wenig durchsetzbar.
Der neue EU-Haushalt wird gemäss der Kommissionsvorschläge im Mai infolge des Brexit niedriger ausfallen. Die auf Deutschland entfallenden Strukturfondsmittel werden wahrscheinlich um etwa ein Fünftel gekürzt. In den meisten deutschen Regionen werden sich die EU-Fördersätze wahrscheinlich von 50 % auf nur noch 40 % reduzieren. Ein Regelwerk für alle Fonds könnte u.a. einen Single Audit vorsehen, bei dem nur noch eine Prüfinstanz z. B. auf der Ebene der Mitgliedstaaten verantwortlich wäre (größere Rechtssicherheit). Die Strukturfonds würden sich inhaltlich auf fünf Ziele ausrichten.
Dieter Rehfeld ergänzte einige Trends bei der Erarbeitung des künftigen Forschungsrahmenprogramms „Horizon Europe“. Erkennbar ist, dass die Leitgedanken „Transition“ und „Missionsorientierte Innovationspolitik“ eine zentrale Rolle spielen werden. In diesem Zusammenhang stehen auch Änderungen wie die Ausweitung der Förderberechtigten wie gemeinwirtschaftliche oder Sozialunternehmen an. Weiterhin wird in den künftigen Projekten noch mehr Wert auf die Auswirkungen (Impact), auf die Veröffentlichung und breite Diffusion der Ergebnisse (Open Science), auf Bürgerbeteiligung (Responsible Research and Innovation) sowie auf die Nutzung der Ergebnisse in anderen Förderprogrammen gelegt werden.
Diese Veränderungen führen dazu, die bisherigen Innovationsstrategien auch in NRW zu überdenken. So wäre eine Hinwendung zu einer stärker nachfrageorientierten Innovationspolitik anstelle vieler kleinteiliger Innovationsvorhaben sinnvoll. Mit einer Missions-Orientierung könnte man eigene Schwerpunkte z.B. im Rahmen einer stärkeren Regionalisierung innerhalb von NRW setzen; dies wäre instrumentell etwa mit den bisher in NRW nicht genutzten Integrierten territorialen Investitionen (ITI) zu unterfüttern.
Die neun Teilnehmenden diskutierten am 18. September 2018 im Unperfekthaus Essen u. a. was die kommenden Änderungen für das Ausgleichs- und Wachstumsziel bedeuten und ob eine Harmonisierung der Regelungen noch eine ungleiche Behandlung ungleicher Dinge ermöglicht. Vor dem aktuellen Hintergrund der Umbrüche im Energiesektor (u. a. Strukturkommission Kohle zum Kohle-Ausstieg, Elektromobilität) wurde der Gedanke einer Konzentration der Gelder in NRW auf die Energiewende kontrovers erörtert.




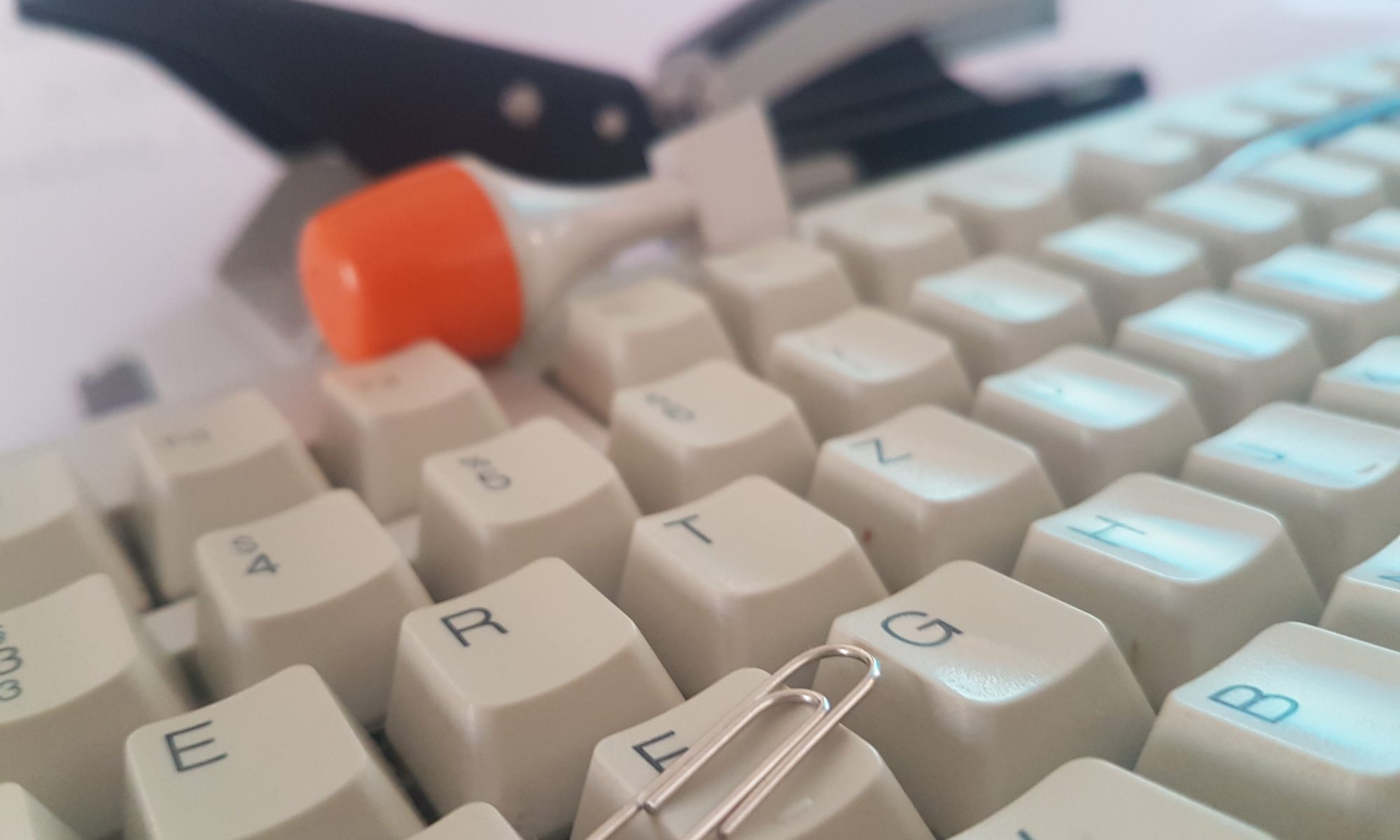



Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.