Welche Kapazitäten „vor Ort“ benötigt eine transformationsorientierte präventive Strukturpolitik in NRW in Zukunft? Wie kann Strukturpolitik bestmöglich im Sinne der Transformation eingesetzt werden? Als Auftakt für unser Jahrestreffen möchten wir diese Fragestellungen in einem gemeinsamen Workshop der GfS und der ARL-Arbeitgruppe „Regionale Strukturpolitik unter Transformationsbedingungen“ am 16. Januar diskutieren. Ziel ist es, Erkenntnisse und Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis zu bündeln und Impulse für eine zukunftsfähige transformative Strukturpolitik in NRW zu geben.
Traditionell war die regionale Strukturpolitik in NRW auf die Stärkung strukturschwacher Regionen und die Begleitung des regionalen Strukturwandels ausgerichtet. Schon seit einiger Zeit hat insbesondere die europäische Strukturpolitik ihren Ansatz verändert und unterstützt etwa im Rahmen des EFRE-Programms innovative Vorhaben, so z.B. der Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft oder der Aufbau einer zirkulären Wirtschaft, in allen Regionen. Aktuelle Entwicklungen wie die Herausforderungen der Gewährleistung der Energiesicherheit, die zunehmende Unsicherheiten von globalen Lieferketten und der fortschreitenden Digitalisierung erzwingen neue Perspektiven und machen in NRW eine präventive und transformative Strukturpolitik notwendig, die
schon vor Eintritt regionalwirtschaftlicher Problemlagen versucht, Rahmenbedingungen, etwa in den Bereichen Infrastruktur sowie Forschung und Entwicklung, zu verändern. Das gilt umso mehr, wenn die regionale Strukturpolitik auf die Anforderungen einer sozialökologischen Transformation ausgerichtet werden soll. So haben strukturpolitische Programme begonnen, sich stärker der ökologischen Herausforderung zu stellen, z. B. die Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“, GRW.
Im Vordergrund des Workshops stehen Fragen nach den geeigneten Kapazitäten, Strukturen und Kompetenzen auf der lokalen Ebene in Verwaltung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik, die Befähigung von Kommunen, transformative Prozesse strategisch und partizipativ zu steuern, und die Frage, welche Akteure und Governanceformen dabei von Bedeutung sind.
Ort: Ruhr-Universität Bochum, Universitätsstraße 150, 44780 Bochum
Programm am 16. Januar 2026:
14:30 Ankunft und Snacks
15:00 Begrüßung
15:15 Impuls & Diskussion „Transformative Strukturpolitik“, Nils Biermann, Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen
16:00 Impuls & Diskussion „Transformationsstrategie Chempark“, Martin Voigt, Currenta GmbH & Co. OHG
16:45 Kaffeepause
17:00 Fokusgruppentische: Vorstellung der Tische im Plenum, im Anschluss Auswahl der Tische und Diskussion in Kleingruppen:
- Tisch 1: Barrieren und Lösungsansätze für eine präventive und transformative Strukturpolitik vor Ort
- Tisch 2: Lokale und regionale Steuerung – Schlüsselakteure und zukünftige Kapazitäten
- Tisch 3: Förderprogramme und Rahmenbedingungen der lokalen Ebene
- Tisch 4: Zukunftsvision präventive und transformative Strukturpolitik
17:40 Zusammenfassungen im Plenum
17:55 Nächste Schritte und Ausklang
Wie immer sind interessierte Gäste nach Anmeldung unter info@strukturpolitik.org herzlich willkommen.
Am 17. Januar werden wir im O-Werk Bochum unsere Mitgliederversammlung abhalten und freuen uns darauf, im Anschluss einen Einblick in die Entwicklungen am ehemaligen Opel-Produktionsstandort „Mark 51-7“ durch Prof. Dr. Manfred Wannöffel zu erhalten.
Herzlichen Dank an den Mitveranstalter ARL für die Organisation sowie an die Referierenden für ihre Beiträge sowie die Bereitschaft zum gemeinsamen Austausch.





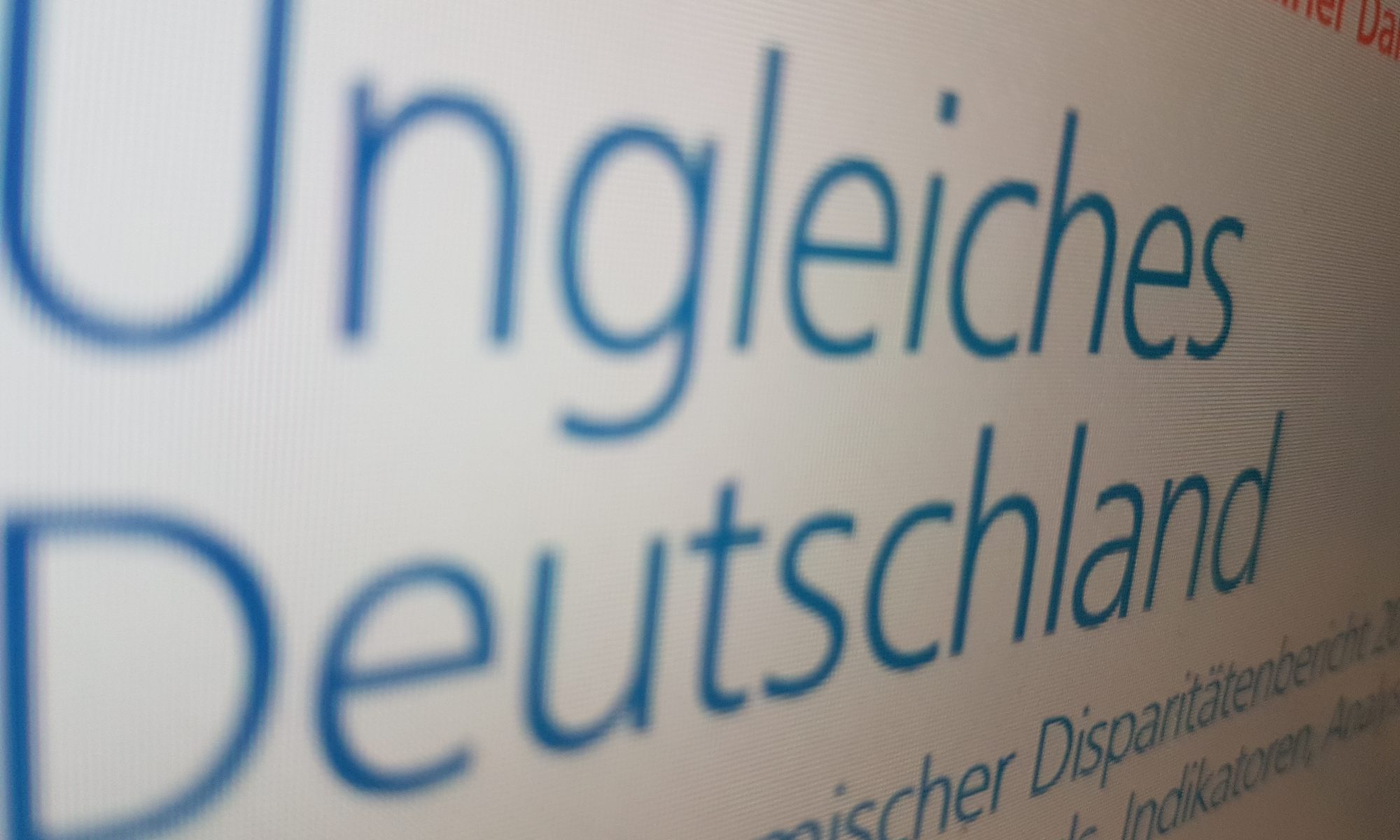

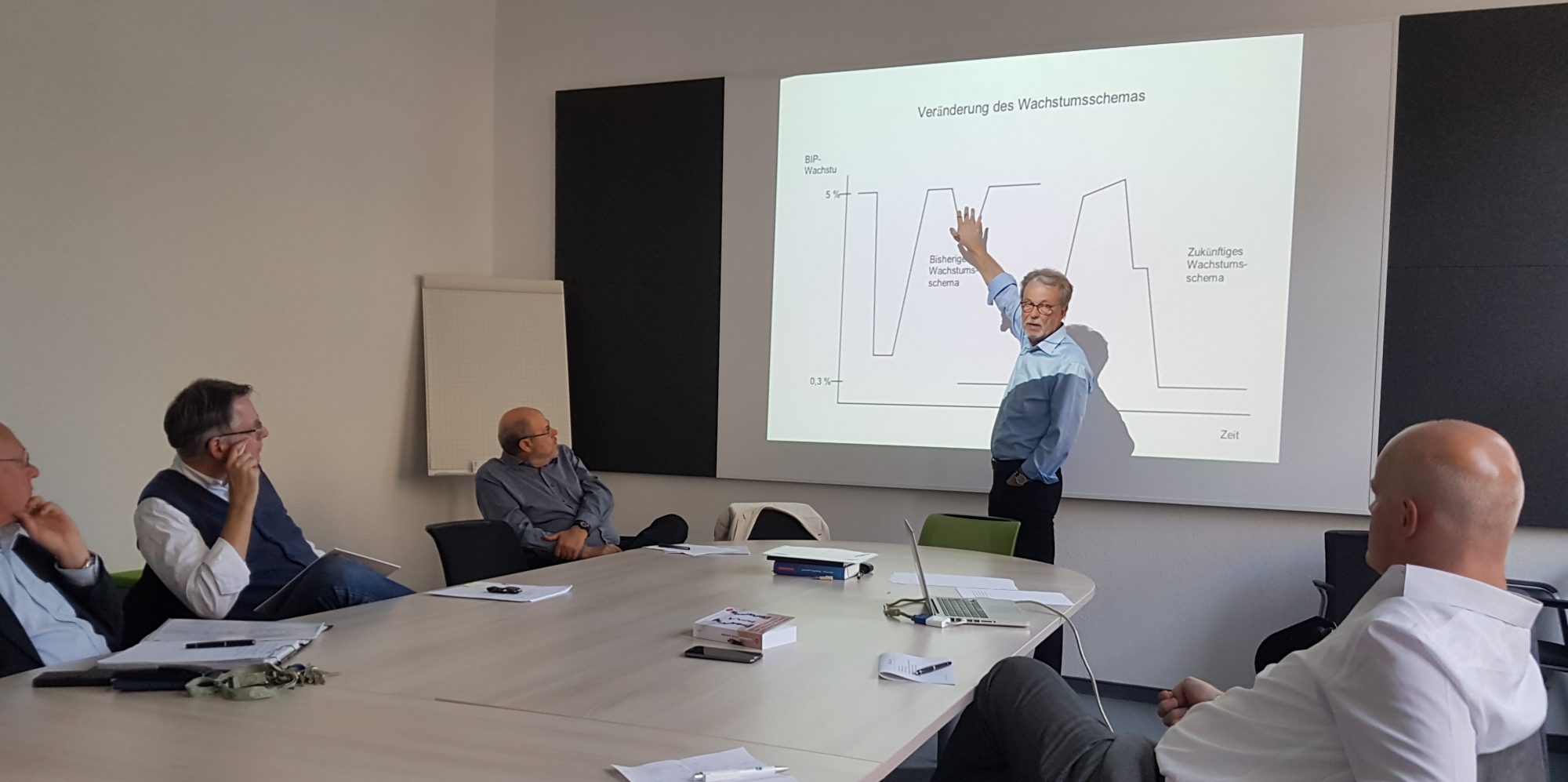
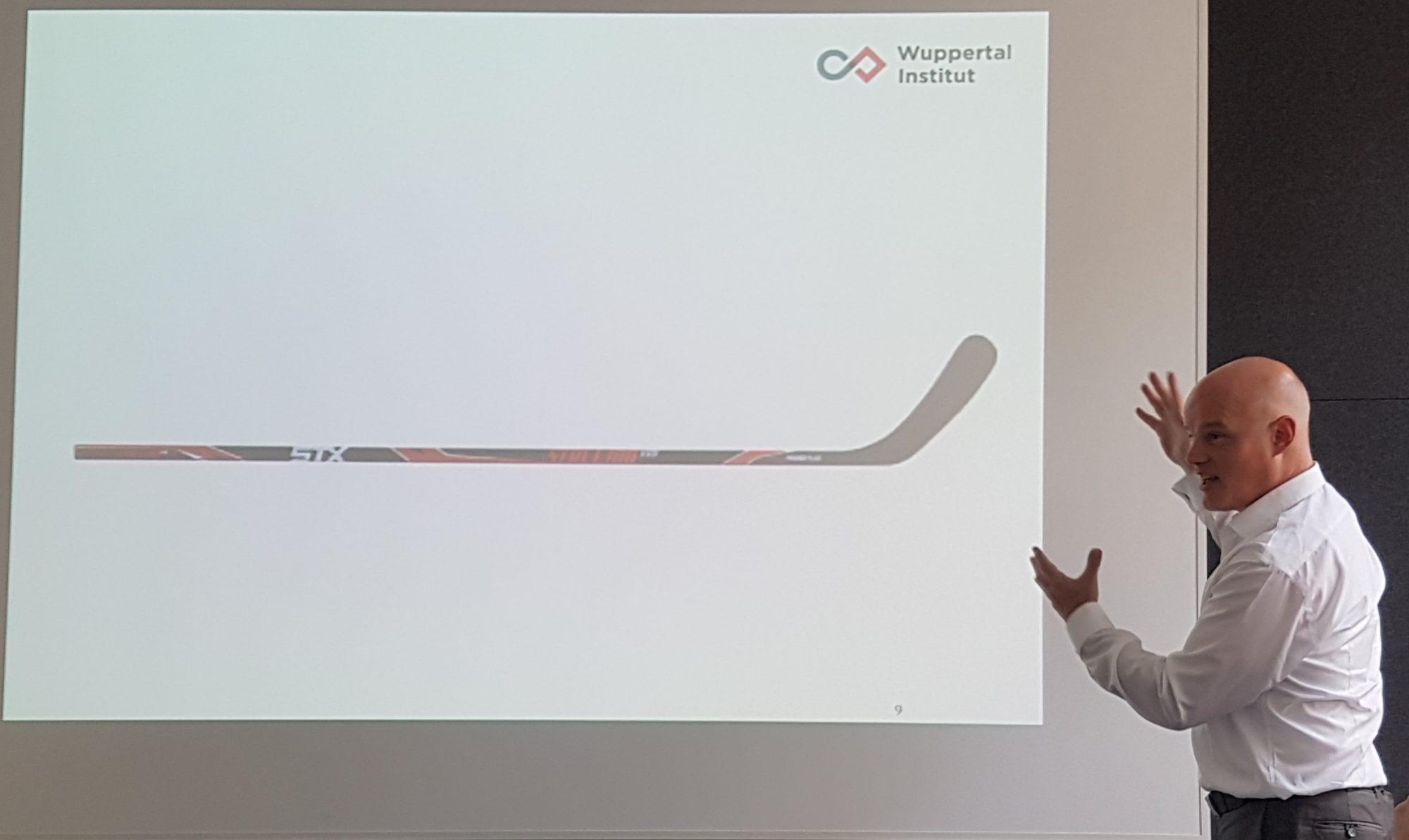
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.