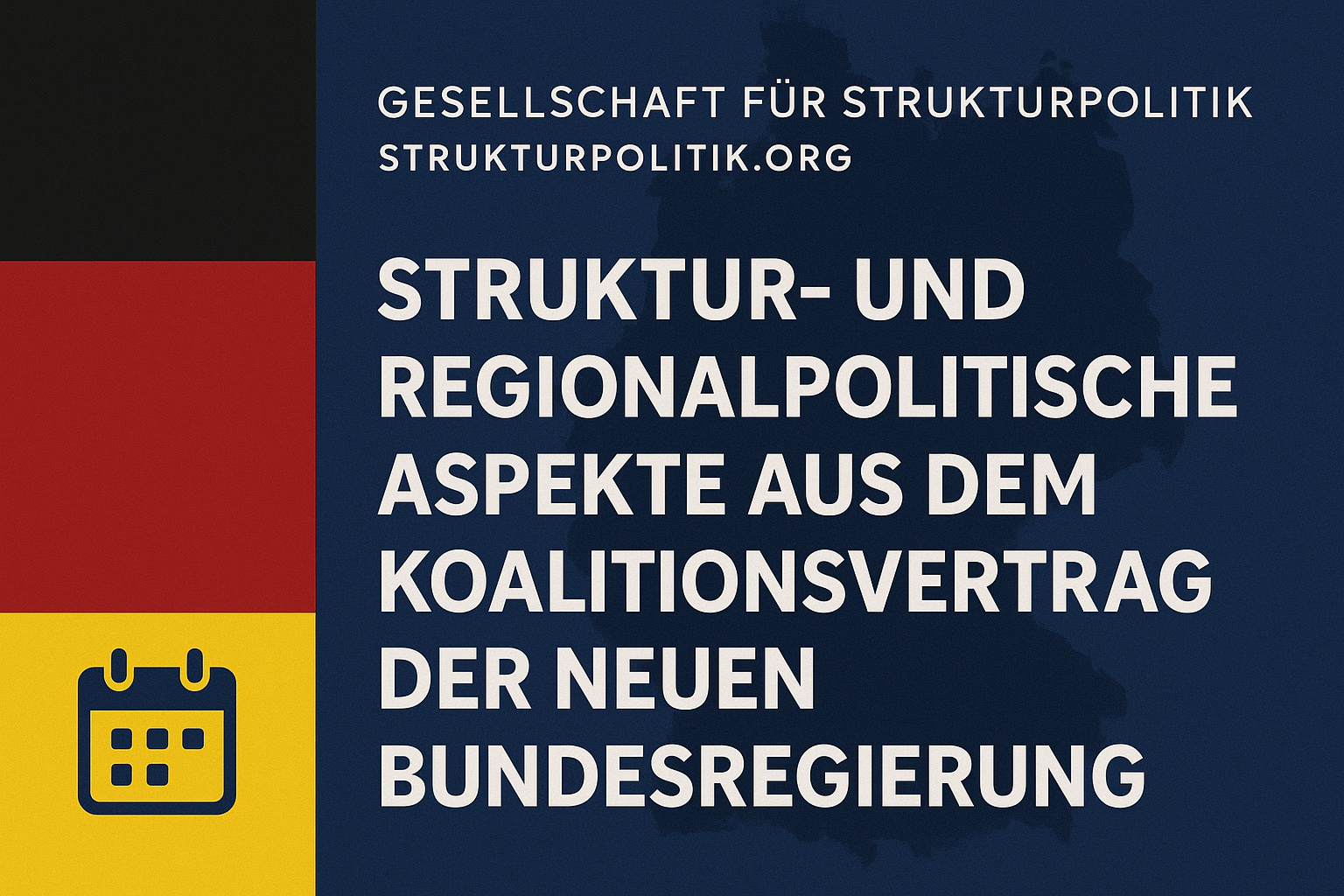Im Nachgang zur Jahrestagung in Bochum lädt uns die Südwestfalen Agentur am 27. und 28. Februar 2026 zu einer Fachexkursion ein. Ziel der zweitägigen Exkursion ist es, die aktuellen Entwicklungen der REGIONALE 2025 im Austausch mit Akteuren vor Ort zu analysieren. Südwestfalen, das bereits 2013 Austragungsort war, nutzt dieses strukturpolitische Instrument des Landes Nordrhein-Westfalen zum zweiten Mal, um regionale Kooperationen und innovative Projektansätze zu bündeln.
Programmschwerpunkte
Die fachliche Begleitung erfolgt durch Dr. Stefanie Arens, Leiterin der Regionalen Entwicklung und Prokuristin der Südwestfalen Agentur.
Freitag, 27.02.2026: Strategische Grundlagen und Konversion
- 11:00 Uhr: Auftakt in der Südwestfalen Agentur (Olpe). Vorstellung und Reflexion der Aktivitäten zur REGIONALE, der Smart-City-Strategie sowie des Regionalmarketings. Ein Grußwort des Landrats des Kreises Olpe, Theo Melcher, ist vorgesehen.
- 14:30 Uhr: Besichtigung von Best-Practice-Beispielen in Kreuztal. Fokus auf industrielle Transformation (Campus Buschhütten / GreenFactory) und das Konversionsprojekt „Holz.Stahl.Digital“, welches bezahlbaren Wohnraum und moderne Arbeitswelten verknüpft.
Samstag, 28.02.2026: Urbane Transformation und Innovation
- 09:00 Uhr: Besuch des Unternehmens eleQtron (Entwicklung und Betrieb von Quantencomputern)
- im Anschluss bis ca. 12:30 Uhr: Transformation der Siegener Innenstadt: REGIONALE 2013-Projekt „Siegen zu neuen Ufern“, Herrengarten, Uni in die Stadt, REGIONALE 2025 Projekt „Zeit.Raum.Region“
Der Transfer zwischen den einzelnen Stationen erfolgt voraussichtlich über bereitgestellte Fahrzeuge der Südwestfalen Agentur. Weiterführende Informationen zur Region sind unter regionale-suedwestfalen.com abrufbar.
Anmeldung: Aufgrund der begrenzten Kapazitäten wird um eine verbindliche Anmeldung unter info@strukturpolitik.org gebeten.
Bereits an dieser Stelle einen herzlichen Dank an unsere Gastgeberin Südwestfalen Agentur sowie die Referierenden vor Ort.