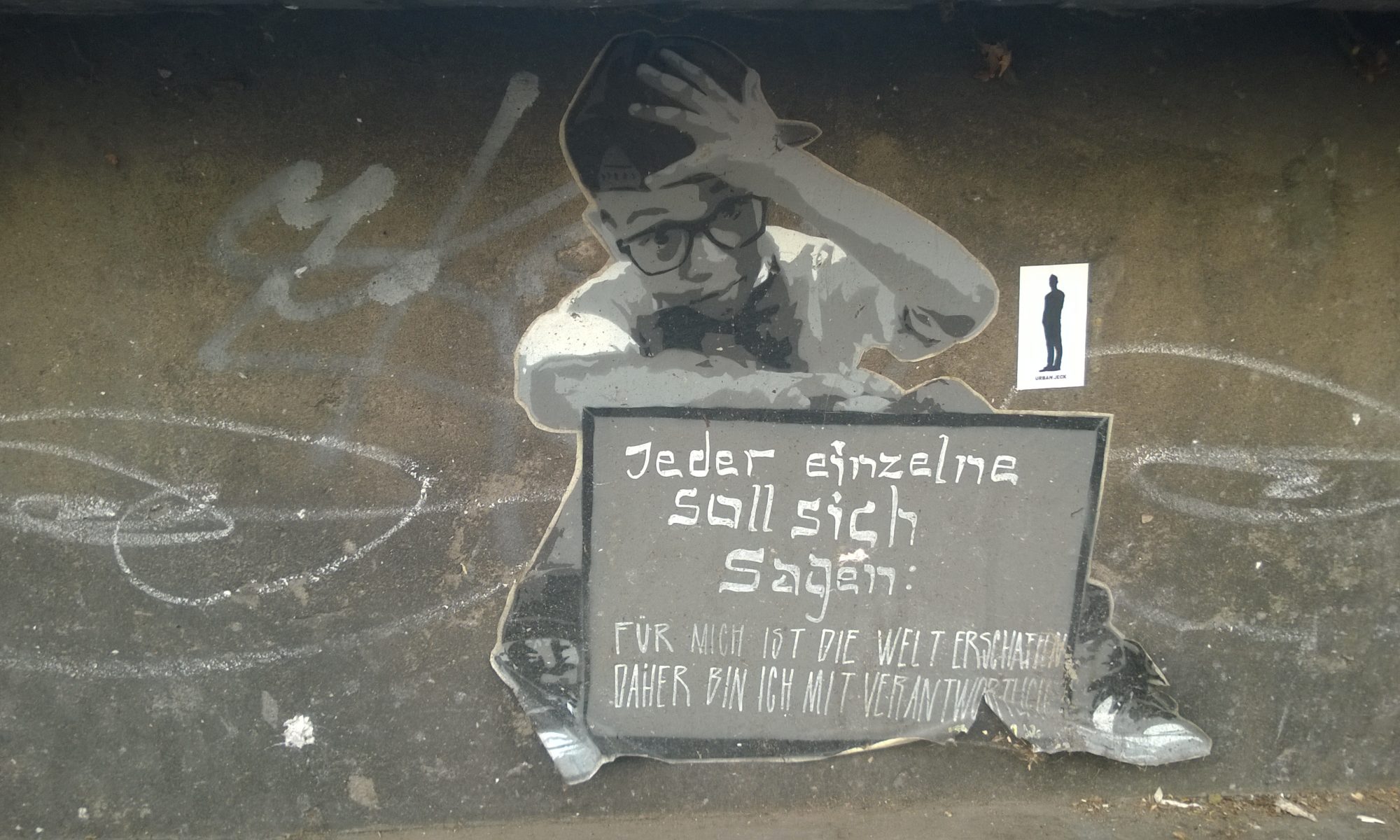Mit einer kurzen Zusammenschau zurückliegender Veranstaltungen, Workshops und Exkursionen der GfS leitete Stefan Berghaus den Abend am 13. März im Essener Unperfekthaus ein. Einig waren sich alle Teilnehmer, dass diese sehr wertvoll für die GfS und ihre Mitglieder waren. Ein festeres Format wäre daher wünschenswert. Sechs Teilnehmende erörterten verschiedene Möglichkeiten der inhaltlichen und organisatorischen Ausrichtung.
Unser Thema: soziale Prävention
Mit sozialer Prävention verbinden sich verschiedene Ziele, die von der Verbesserung der Teilhabe an Bildung und Gesellschaft bis zur Entlastung der öffentlichen Haushalte geht. In 18 Modellkommunen hat das Landesvorhaben „Kein Kind zurücklassen! Kommunen in NRW beugen vor (KeKiZ)“ seit etwa 3 Jahren Veränderungen im Präventionsangebot in Gang gesetzt.
Regina von Görtz und Frank Osterhoff informierten im Essener Unperfekthaus über das Vorhaben und erörterten die wichtigsten Forschungserkenntnisse aus der Begleitevaluation der Bertelsmann Stiftung. Martin Hennicke kommentierte aus Sicht des Landes NRW. Zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutierten die Erklärungsansätze für Benachteiligung („auf die Adresse kommt es an“), erfolgreiche Präventionsstrategien im sozialen Nah-Umfeld betroffener Familien („ungleiches ungleich behandeln“) sowie die Messbarkeit der gesellschaftlichen und fiskalischen Erfolge von sozialer Prävention („Prävention braucht einen langen Atem“).
Unser Thema: Zukunftsfähigkeit kommunaler Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderungen stehen vor großen Herausforderungen. Marktliche Entwicklungen wie Digitalisierungsprozesse, neue branchenübergreifende Geschäftsmodelle oder Internationalisierungen gestalten Bestandspflege anspruchsvoller. Zugleich wachsen die Anforderungen an Wirtschaftsförderung mit Blick auf Strategieentwicklung und integrierte Herangehensweisen.
Andrea Hoppe gab im Essener Unperfekthaus einen ersten Überblick über die Zwischenergebnisse eines Projektes, in dessen Rahmen Gespräche mit zahlreichen Wirtschaftsförderungen in NRW und in weiteren Bundesländern geführt worden sind. Demnach scheint es eine Rückbesinnung auf die klassische einzelbetriebliche Unternehmensbetreuung zu geben, während die Forcierung von Clusterinitiativen für die Tätigkeit der Wirtschaftsförderung an Bedeutung verlieren. Zugleich werden integrierte Ansätze mit Blick auf Stadtentwicklung, Arbeitsmarkt und Ressourceneffizienz immer wichtiger. Fünf Teilnehmende diskutierten die Fragen, ob die Entwicklungen zu begrüßen sind, welche Konsequenzen diese haben und welche Rolle Wirtschaftsförderung auf der lokalen Ebene spielen kann.
Unser Thema: Stadt – Umland – Land (Siedlungsentwicklung – „Neue Übergänge“)
Frank Wältring eröffnete im Essener Unperfekthaus den Diskurs mit einer Betrachtung auf der Makro-Ebene. Eine regionale Bestandsaufnahme im Rheinland hat Themen und Leitbilder für verschiedene Teilräume ergeben, die u.a. bei der Bildung von (projektbezogenen) Kooperationen zwischen Akteuren helfen können. Bei der Überleitung zur Mikro-Ebene wechselte er zur Perspektive einer Ortschaft in einem ländlich geprägten Teil Westfalens. Dort steht mit dem LEADER-Programm zwar ein regionales Management zur ländlichen Entwicklung zur Verfügung. Dessen kleinräumige Gebietskulisse ist zur Bildung von Kooperationen zwischen Mittelstädten und dem ländlichen Umland jedoch nur bedingt geeignet.
Die fünf Teilnehmenden unterstützen den Input-Vortrag mit ihren Erfahrungen. So wurden spezifische Vor- und Nachteile der Regionalentwicklung in ländlichen Gebieten im Vergleich zu Metropolräumen erkannt. Zudem wurde der Gedanke formuliert, dass kommunale Wirtschaftsfördergesellschaften nicht die Vorreiter von ganzheitlichen und räumlichen Innovationsansätzen sind. Zugleich sind solche Ansätze notwendig, um wirtschaftliche, soziale und grüne Ansätze zusammenzudenken sowohl in ländlich-mittelstaedtischen Räumen als auch in Metropolregionen. In diesem Bereich besteht eine Lücke sowohl in der Raumplanung als auch in der Verknüpfung von neuen Förderansätzen.
Unser Thema: Gewerbeflächen
Das Thema wurde am Beispiel der Weiterentwicklung des regionalen Gewerbeflächenmangagements im Ruhrgebiet angegangen. Martin Tönnes, Bereichsleiter Planung des Regionalverbands Ruhr, erläuterte u.a. die Flächenbedarfsprognose, welche auf Basis eines Markt-Monitorings erfolgt. Gemeinsam mit Rainer Danielzyk stellte er die Zusammenhänge mit planerischen Erwägungen dar. So z.B. das Ziel einer Begrenzung der Flächen-Neuinanspruchnahme zugunsten der Brachflächenreaktivierung im Kontext der aktuellen Diskussion des Landesentwicklungsprogramms und die Stärkung bestehender Siedlungsgebiete.
Sieben Teilnehmende im Essener Unperfekthaus erörterten anschließend die Möglichkeiten, die Grenzen und die Legitimation planerischen Handelns im Gewerbeflächenmarkt. Dabei wurde deutlich, dass die bisherigen Treiber Handel und Logistik auch zukünftig die Schwerpunktbranchen im Gewerbeflächenmarkt darstellen werden.